Am vergangenen Freitag stellte die nigerianische Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie ihren aktuellen Roman, „Americanah“, der nun ins Deutsche übersetzt wurde, in der Kulturbrauerei Berlin vor. Die Lesung stieß auf großes Interesse und wir, accalmie und Charlott, konnten uns glücklich schätzen Tickets ergattert zu haben.
Die Journalistin Susanne Weingarten moderierte das Panel und übersetzte Adichies Aussagen aus dem Englischen. Adichie trug nach einer Einleitung von Weingarten kurz die ersten Seiten des Romans vor, und wurde dann im Wechsel zu Lesungen von Passagen aus der deutschen Übersetzung Americanahs durch Anna Thalbach zu ihrem Werdegang, literarischem Wirken und politischen Positionen interviewt.
Angesichts der Vielzahl von Literaturwissenschaftler_innen und antirassistischer Aktivist_innen im Publikum stellte sich recht früh die Frage, warum nicht eine_r jener angefragt worden war für die Moderation. Während Adichie und die Lesung von Americanah für Begeisterung sorgten, konnte Weingarten nicht nur mehrere Namen nicht aussprechen (womit sie den Rest des Abends kokettierte), sondern fand es auch sinnvoll, Adichie als „Modeikone“ vorzustellen, als eine Person, die „eigentlich zu jung“ sei, um solche Bücher schreiben zu können, und fragte gleich, welche Anekdoten der Schwarzen Protagonistin Americanahs denn alle aus dem Leben der Autorin stammten. Diese „Verwechslung“ von Lyrischem Ich und Autor_in passiert häufig, jedoch auffällig oft bei nicht-weißen, nicht-männlichen Autor_innen; denn obwohl biographische Bezüge bei Literaturanalysen sonst belächelt bis verpönt werden, sind jene bei nicht-weißen, nicht-männlichen Autor_innen wohl eine der Grundannahmen.
Adichie antwortete, dass ihr Leben nicht das der Protagonistin sei, sondern viel „langweiliger“ – gab dann aber ein Erfahrungsbeispiel zu Rassismus, das nicht im Buch vorkam: nämlich die Reaktion eines Professors während ihres Studiums in den USA, der in einem Seminar fragte, wer diesen – den besten – Aufsatz geschrieben habe, und als sie sich meldete, sehr überrascht aussah; ein Hinweis darauf, dass er nicht damit gerechnet hatte, dass eine Schwarze Autorin besser schreiben könnte als ihre weißen Kommiliton_innen.
Weingarten wurde schließlich von Teilen des Publikums darüber in Kenntnis gesetzt, dass das oft wiederholte Wort „Rasse“ ein problematischer Begriff ist und „race“ so nicht übersetzt werden könne. Es entbrannte eine kurze Debatte, wie Deutsche denn dann Rassismus und „race“ benannten – „meistens gar nicht,“ tönte es lakonisch aus dem Publikum. Adichie selbst blieb hier etwas außen vor, da für sie in dieser Debatte kaum etwas übersetzt wurde. Weingarten entschied sich letztlich dafür, weiterhin von „Rassen“ zu sprechen – den Ausdruck aber in „Anführungsstriche“ zu setzten oder ironisch zu intonieren.
Auch gelang es Weingarten nicht, die in Adichies Americanah pointiert verhandelten Differenzkategorien und verschiedenen Formen von Diskriminierung auf einen nicht-US-amerikanischen Kontext zu übertragen. Dass Rassismus und Sexismus und Klassenunterschiede auch etwas mit Deutschland zu tun haben könnten, war erst gar nicht auf dem Horizont (sondern ein US-amerikanisches Problem). Stattdessen wurde Adichie gefragt, wie sie überhaupt die ganzen Themen „race, class und gender“ in ihrer Erzählung untergebracht hätte.
Auf die obligatorische Frage nach Adichies eigentlicher „Heimat“ antwortete sie, dass Konzepte von Heimat immer im Fluss seien: Nigeria sei für sie „Heimat-Heimat“, und die USA eine „Sozusagen-Heimat“. Als sie nach vier Jahren nach Nigeria zurückkehrte, war sie enttäuscht, dass das Land nicht „auf sie gewartet“ habe. Damit verbunden waren Gefühle von Trauer und Nostalgie, aber auch die Feststellung, dass „Heimat“ häufig als etwas Statisches imaginiert wird, es aber nicht ist.
Zuletzt äußerte sich Adichie noch zu #BringBackOurGirls: Vor kurzem veröffentlichte sie einen Essay, der Nigerias „schweigende Regierung“ kritisierte, die gegenüber der „schrecklichen Präsenz“ Boko Harams tatenlos zusähe. Ihr Essay beschäftigte sich primär mit Boko Harams Bombenanschlägen in Abuja. Adichie sagte, dass sie Schreiben als eine Intervention begreife; als etwas, das sie tun könne, auch wenn sie wisse, dass es nur einen begrenzten Einfluss habe. Geschrieben hat sie The President I Want (Den_die Präsident_in, den_die ich will), und auch beim Magazin The New Yorker erscheinen ihre Kommentare.
Charlotts Buchbesprechung zu (der englischen Ausgabe von) Americanah.
Ein Video der Veranstaltung findet sich auf youtube.
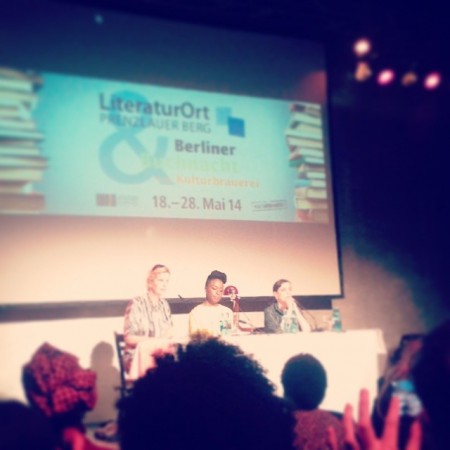
Oh mann wie peinlich! Oder eigentlich wie schrecklich, dass so eine person die Veranstaltung moderieren durfte. Schade, dass die Debatte um den Begriff „Race“ nicht für die Autorin übersetzt wurde. Mich hätte ihre Meinung sehr interessiert. Als Alternative dazu empfehle ich die euphorische Kritik in der aktuellen ZEIT.
Werde mir das Buch bestimmt auch holen.
„Angesichts der Vielzahl von Literaturwissenschaftler_innen und antirassistischer Aktivist_innen im Publikum stellte sich recht früh die Frage, warum nicht eine_r jener angefragt worden war für die Moderation.“
allerdings!
nach lektüre des artikels frage ich mich, welche möglichkeiten chimananda adichie einerseits und beliner Literaturwissenschaftler_innen und antirassistischer Aktivist_innen andererseits haben, den ablauf, die gestaltung, den rahmen eines solchen abends (in der zukunft) (mit) zu bestimmen.
durch euren artikel und einem blick ins you tube video wird so klar, wie wichtig das wäre!